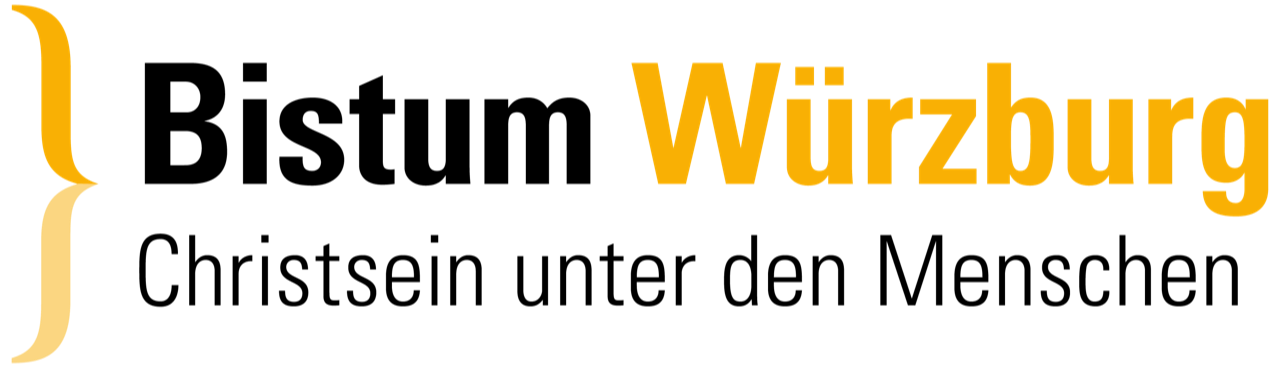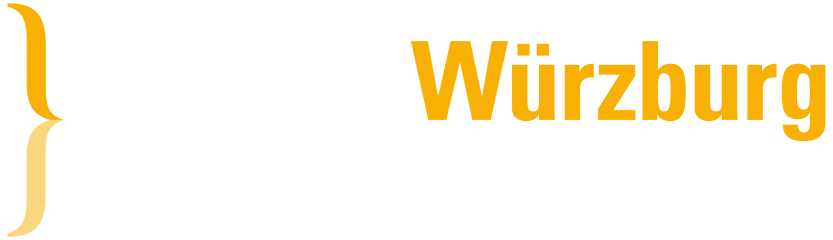Evangelium
Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen.
Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern; das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren.
Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten.
Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes.
Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte.
Johannesevangelium 2,13–22
Seinen Namen verdankt St. Canisius einem der ersten Jesuiten Deutschlands: Petrus Canisius. Ein Jesuit war es auch, der mich in der wahrscheinlich modernsten Berliner Kirche 2005 in die katholische Kirche aufgenommen hat. An den Tag meiner Konversion erinnere ich mich gut. Im Gottesdienst kam die Sonne heraus und tauchte das sehr nüchtern gestaltete Kirchenschiff durch die großen Südwestfenster in ein warmes Licht.
Die außen wuchtige, aus Sichtbeton gefertigte Kirche ist sicher nicht jedermanns Sache. Doch es sind die architektonischen Besonderheiten, die mich faszinieren. Etwa die aus Lärchenholz gefertigte Marienkapelle. Oder der freistehende Tabernakel, der durch eine Röhre zum Himmel hin vom Lichteinfall hervorgehoben wird. Beeindruckend ist zudem das hölzerne Eingangsportal, das sich bis auf eine Höhe von elf Metern öffnen lässt und der Welt signalisiert: Unser Gott ist einladend! Zur jesuitischen Spiritualität, Gott in allen Dingen zu entdecken, passt auch, dass sich das Straßenpflaster im Inneren der Kirche fortsetzt. Es gibt keine Kanzel. Priester und Gläubige begegnen sich hier auf Augenhöhe.
Für mich hat 2005 ein neues Leben begonnen. Beruflich und privat. Auch St. Canisius hatte einen Neubeginn erfahren. Die alte Kirche war 1995 abgebrannt. Sie wurde deswegen zu Beginn des Jahrtausends komplett neu gebaut.
Andreas Kaiser
Das Freiburger Münster ist für mich ein Anker, der Erinnerungen an einen Ort festhält, den ich längst verlassen habe. Es erinnert mich an Abende im Studium, an denen ich einem Chor lauschte, während das Licht durch die bunten Fenster zog und diesen dunklen Ort für die Dauer eines Sonnenuntergangs strahlen ließ. An frühe Morgen auf dem Münstermarkt, an denen ich mit antrainiertem großen Schritt über das Bächle sprang – in der Luft: der Duft von Blumen, Backwaren, Sonnencreme.
Das Münster ist aber nicht nur für mich eine Erinnerung. Es ist Geschichte, die man sich bis heute erzählt – von Generation zu Generation. Von der Nacht 1944, als fast die gesamte Altstadt im Bombenhagel versank, nur der Münsterturm noch stand, weil die Druckwellen durch das Dachgewölbe entwichen. Von den Details, die sich nur bei genauem Hinsehen zeigen: Maßeinheiten für einen Laib Brot am Sockel der Kirche – eingeritzte Erinnerungen aus dem Mittelalter.
Auch wenn der Anblick der roten Sandsteinmauern irgendwann ein gewohnter war: Oft blieb ich an den unterschiedlichsten Punkten der Stadt stehen, Kopf im Nacken, staunend, besonders bei Sonnenauf- und -untergängen: So golden thront das Münster über der Stadt. Ein Geschenk für alle, die dort leben – oder gelebt haben.
Lisa Discher
Es war der Wasenmeister Bartholomäus Deibler, der um 1670 eine kleine offene Feldkapelle weit vor den Toren Münchens errichtete. Bald kamen viele Menschen. 1705 schuf man einen Zentralbau mit Kuppel, die „Schmerzhafte Kapelle“. Nach der Säkularisation ließen sich hier 1846/47 die Kapuziner wieder in München nieder.
Da ich in der Isarvorstadt aufgewachsen bin und bis heute nicht weit entfernt wohne, kenne und schätze ich diesen Ort. Jugendgottesdienste, Maiandachten und adventliche Roratemessen haben wir hier gefeiert. Alljährlich errichteten wir hier unser Heiliges Grab. Hier habe ich geheiratet und auch meine Silberhochzeit gefeiert.
Vor knapp 20 Jahren wurde der Raum verändert: Im Rahmen des großen Umbaus des alten Kapuzinerklosters trennte man vom historischen Kuppelbau das Langhaus ab. Dort befindet sich heute das Fernsehstudio des Instituts für publizistische Ausbildung (ifp), das seit damals hier beheimatet ist.
Oft schaue ich auf einen Sprung vorbei, zünde eine Kerze an, halte inne. Nach dem Blick auf Kreuz und Pietà darf ich hier bei jedem Besuch erfahren, dass Schmerz, Leid und Tod in unserem Leben nicht das letzte Wort haben. Denn über dem Portal hängt ein altes Bild des auferstandenen Christus, auf den der Blick beim Verlassen fällt, bevor man wieder hinaus in den Alltag tritt.
Florian Ertl
Ist es möglich, dass wir uns in der einen Kirche Gott näher fühlen als in der anderen? Diese Frage stelle ich mir immer, wenn ich in die Kapelle des Heimsuchungsklosters in Paray-le-Monial in Burgund einkehre. Eine Malerei an der Apsis zeigt eine Szene, wie sie die Ordensfrau Marguerite-Marie Alacoque im 17. Jahrhundert in mehreren Visionen erlebte. Auf der einen Seite Jesus am Kreuz mit seinem geöffneten Herzen; aus seinen Wunden entsteht ein Leuchten, das bis zu der vor ihm knienden Schwester reicht. Wenn ich auf das Bild schaue, bin ich mir immer sicher: Auch auf mich fallen diese Strahlen, seine Liebe umfängt mich.
1673 in Frankreich, es ist die Zeit des Jansenismus. In der Verkündigung steht der vermeintlich strafende Gott im Mittelpunkt. Da erlebt Marguerite-Marie während der Anbetung diese Visionen. Jesus zeigt ihr seine unendliche Liebe, indem er ihre beiden Herzen miteinander vereinigt. Barmherzig will er sein, nicht strafend. Dass wir heute allmonatlich den Herz-Jesu-Freitag feiern, geht auf diese Erscheinungen zurück.
Die Klosterkapelle ist kein üppiger Bau, kunsthistorisch wahrscheinlich von geringer Bedeutung. Es ist diese Botschaft der Liebe, die das Gebäude für mich so anziehend macht. Und die mir das Gefühl gibt, ganz zu Hause zu sein. Geliebt zu sein von Herz zu Herz. Hier ist mir Gott ganz nah.
Matthias Petersen