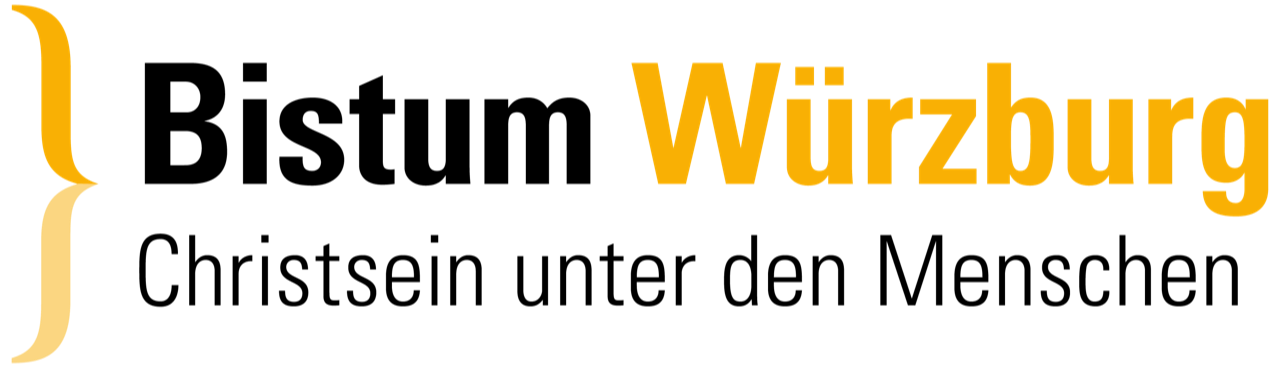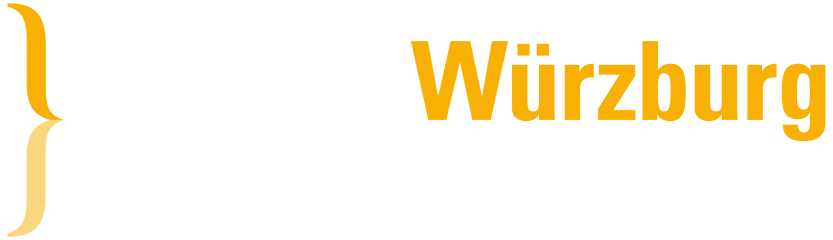Evangelium
In jener Zeit begleiteten viele Menschen Jesus; da wandte er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein.
Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen: Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen.
Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.
Lukasevangelium 14,25–33
Wer das Gotteslob unter der Nummer 380, „Großer Gott, wir loben dich“, aufschlägt, findet rechts unten ein Zitat: „Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten.“ Es stammt von Karl Rahner, den viele bis heute für einer der schärfsten theologischen Denker halten und über dessen komplexe Gedankengänge und Formulierungen Generationen von Studierenden nachgrübelten. Der Satz scheint nicht zu ihm zu passen, schließlich war die Dogmatik sein Fach, die kirchliche Lehre über Himmel und Erde und alles, was dazwischen ist.
Andreas Batlogg aber sagt, der Satz passe doch: „Je älter Rahner wurde, desto vorsichtiger wurde er mit seinen Aussagen über Gott.“ So sprach er in seiner letzten großen Rede, wenige Wochen vor seinem Tod, davon, dass er sich über sich selbst erschrocken habe: Er sei nämlich allzu oft in seinem akademischen Leben zu sicher gewesen und habe vergessen, „dass alles, was wir über Gott sagen, ihm eher unähnlich als ähnlich ist“.
Das soll heißen: Auch Zuschreibungen wie Liebender, Barmherziger, Gnädiger seien immer nur kleine Ausschnitte des großen Gottes, der in der Bibel auch ganz anders geschildert wird – zornig, richtend, rächend. Rahner sagte wörtlich: „Ich möchte bekennen, dass ich als einzelner armer Theologe bei all meiner Theologie zu wenig an diese Analogheit aller meiner Aussagen denke.“ Er riet auch allen anderen, die „von den Kathedern, von den Kanzeln und aus den geheiligten Dikasterien der Kirche“ lehren, dies zu bedenken.
Höchstens Teile der Wahrheit
Batlogg ist wie Karl Rahner Jesuit und hat sich intensiv mit dem Lebenswerk des 1984 verstorbenen Theologen beschäftigt. Er sagt: „Rahner wurde zunehmend sensibel gegen alle Versuche, uns Gott irgendwie verfügbar zu machen.“ Verfügbar machen – auch durch Gebete, die bitteschön in Erfüllung gehen, durch Opfer, die bitteschön belohnt werden sollen. Und durch dogmatische Sätze, die als zweifelsfrei wahr behauptet werden. „Rahner wusste, dass wir uns Gott immer nur annähern können“, sagt Batlogg. „Wir sind keine Besitzer der Wahrheit, wir kennen höchstens Teilwahrheiten.“
Auch das alttestamentliche Buch der Weisheit ist pessimistisch, was das menschliche Denken betrifft. „Unsicher sind die Überlegungen der Sterblichen und einfältig unsere Gedanken“, heißt es dort, und: „Wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht, und finden nur mit Mühe, was auf der Hand liegt; wer ergründet, was im Himmel ist?“ Ist das nicht ein Angriff auf die Theologie insgesamt, das wissenschaftliche Nachdenken über Gott und den Glauben?
Nein, sagt Batlogg. „Im ersten Petrusbrief steht, dass wir in der Lage sein sollen, Rechenschaft zu geben, Rede und Antwort zu stehen über unseren Glauben.“ Dass die Rede von Gott „argumentativ belastbar“ sein muss, davon sei Rahner, der nicht nur Theologe, sondern auch Philosoph war, überzeugt gewesen. Das zeigt auch ein anderer Satz Rahners aus seiner letzten Rede: „Von Gott kann man erst schweigen, wenn man von ihm gesprochen hat.“
Deshalb hält Batlogg auch nichts von manchmal gehörten Sätzen wie: Theologinnen und Theologen sollten weniger kritisch denken und mehr beten – oder: Theologie könne man nur auf Knien betreiben. „Das sind Polemiken aus bestimmten Ecken“, sagt der Jesuit. „Forschen und beten kann man nicht gegeneinander ausspielen.“ Er zitiert die alte Geschichte von seinem Ordensgründer Ignatius von Loyola, dem einmal zwei Kandidaten vorgestellt wurden, der eine sehr klug, der andere sehr fromm: „Da hat er gesagt: Ich nehm’ den G’scheiten, der kann noch fromm werden, aber wer nur fromm ist, passt nicht in diesen Orden.“
Klug und fromm – das gilt sicher auch für Karl Rahner. „Er gilt manchen als moderner Mystiker“, sagt Batlogg. „Eben weil er das Geheimnisvolle Gottes und seine Unbegreiflichkeit immer gesehen hat.“ Aber das sei „auch etwas Quälendes, weil ich wie Sisyphos nie zu einem Ende komme“. Man könnte ja sagen, so Batlogg, „Rahner war Dogmatiker, er wusste doch alles! Aber so war es eben nicht. Rahner wusste, dass wir immer Suchende bleiben, vielleicht Ahnende.“ Dass es da, wie Rahner sagte, „die unheimliche Schwebe zwischen Ja und Nein“ gebe. „Und“, ergänzt Batlogg, „dass da manchmal eine große Nähe zu Gott sei und manchmal eine große Distanz“.
Ein Weiser kennt seine Grenzen
Aber können wir denn gar nichts Sicheres über Gott sagen? Doch, sagt Batlogg, denn einerseits gebe
es Glücksmomente im Glauben, in denen wir Gott erfahren. Und außerdem hätten wir ja Jesus: „Im Johannesevangelium sagt Jesus: Wer mich sieht, sieht den Vater. Daran können wir uns orientieren.“ Auch Rahner habe das so gesehen: „In einer Predigt sagte er einmal: In Jesus wissen wir, was wir an Gott haben. Anders nicht!“
Und noch etwas ist wichtig: Kluge Worte reichen nicht, sie müssen im Leben tragen. „Auch ein Karl Rahner hatte Angst vor dem Sterben, vor Schmerz, vor Leid“, sagt Batlogg. „Er wusste, dass Gott nicht vor etwas bewahrt, aber er bewahrt in etwas: nicht vor Leid, aber im Leid.“
Was kann man über Gott wissen? Im Buch der Weisheit heißt es: „Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast?“ Gilt das auch für Karl Rahner? War er in diesem Sinne ein Weiser? Batlogg sagt: „Ja, ich glaube schon. Als Professor war er ein Wissender, aber er war auch ein Weiser, der um die Begrenztheit seines Wissens wusste.“ Darin war Rahner sicher so manchem voraus, der damals wie heute meint, die Wahrheit über das, was im Himmel ist, ganz genau zu kennen.
Susanne Haverkamp