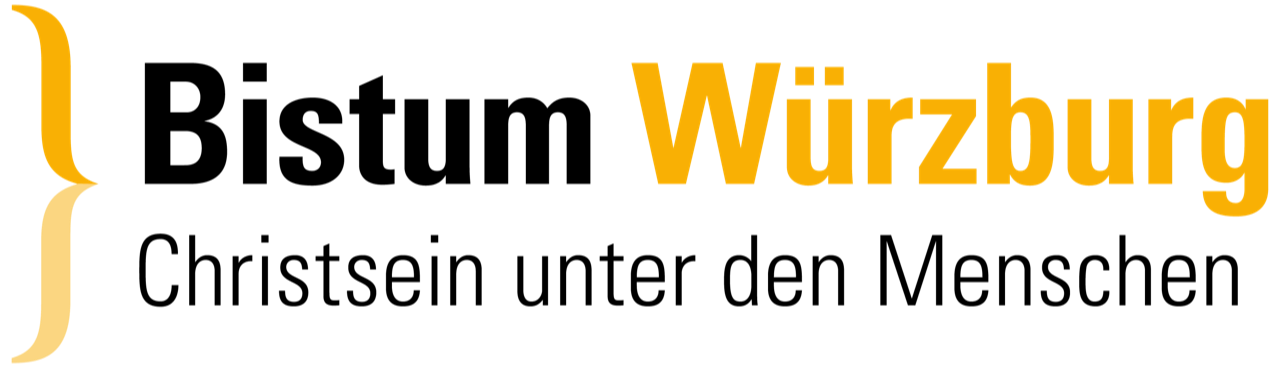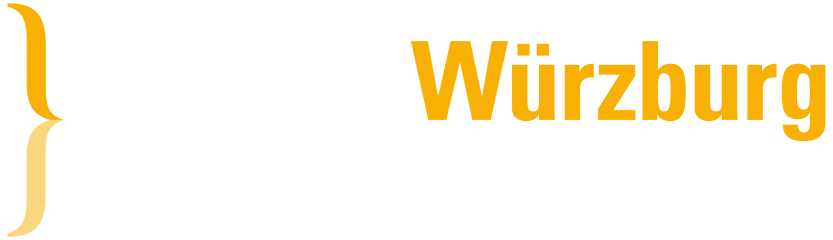Unser aktueller Flyer
Wer sind wir?
- Betroffene sexueller Gewalt im kirchlichen Kontext
- Frauen und Männer, die sich nicht als Selbsthilfegruppe verstehen, sondern sich bewusst und mutig zu ihrer Vergangenheit bekennen
- Interessensvertretung der Betroffenen von sexualisierter Gewalt gegenüber dem Bistum Würzburg
Was wollen wir?
- Konstruktives Engagement in der Aufklärung und Prävention sexueller Gewalt
- Hilfe leicht und schnell ermöglichen
- Lotsenfunktion für Betroffene, um sich im Dickicht der Hilfsangebote zurechtzufinden
- Austausch und Zusammenarbeit mit Betroffenen im Bistum Würzburg
- Planung und Durchführung regelmäßiger Treffen Betroffener
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Betroffenenbeiräten anderer Diözesen
- Stärkung der Prävention durch Fokusierung auf die psychologische bzw. traumatherapeutische Bedeutung von Missbrauch
- Denen, die die Sprache aufgrund ihrer Lebensgeschichte verloren haben, eine Stimme geben
FAQs
- Kontakt zum Betroffenenbeirat
Email: betroffenenbeirat@bistum-wuerzburg.de
- Regelmäßige Informationen unter: www.bistum-wuerzburg.de/seelsorge-hilfe-beratung/betroffenenbeirat
- Obwohl der Beirat institutionell mit dem Bistum Würzburg verbunden ist, geschieht die inhaltliche Arbeit völlig unabhängig.
- Es besteht keine Verpflichtung gegenüber der Diözese Würzburg.
- Sitzungen des Beirates sind vertraulich und nicht öffentlich.
- Alle Anfragen werden streng vertraulich behandelt.
- Es besteht die Möglichkeit - je nach Wunsch - mit einer Frau oder einem Mann in Kontakt zu treten.
- Anonyme Anfragen werden aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen nicht bearbeitet. Wir bitten um ihr Verständnis.